 (switch to the English version) Auf der next09 in Hamburg habe ich ein Interview mit Jeff Jarvis über die Chancen des Medienwandels in den USA und in Deutschland geführt. Das Interview erscheint jetzt auf diesem Blog als zeitgleiches Pendant zu meinem Jeff Jarvis Portrait im neuen mediummagazin (Zugriff auf das Portrait derzeit nur für Abonnenten, frei online mit Erscheinen der nachfolgenden Ausgabe).
(switch to the English version) Auf der next09 in Hamburg habe ich ein Interview mit Jeff Jarvis über die Chancen des Medienwandels in den USA und in Deutschland geführt. Das Interview erscheint jetzt auf diesem Blog als zeitgleiches Pendant zu meinem Jeff Jarvis Portrait im neuen mediummagazin (Zugriff auf das Portrait derzeit nur für Abonnenten, frei online mit Erscheinen der nachfolgenden Ausgabe).
 Ihr neues Buch trägt den Titel „Was würde Google tun“? Medienhäuser sollen diesen Titel als Ratschlag auffassen, so zu werden wie Google. Aber sollte der Rat nicht besser lauten: Was kann Google nicht tun? Was können Medien besser machen als Google?
Ihr neues Buch trägt den Titel „Was würde Google tun“? Medienhäuser sollen diesen Titel als Ratschlag auffassen, so zu werden wie Google. Aber sollte der Rat nicht besser lauten: Was kann Google nicht tun? Was können Medien besser machen als Google?
Jeff Jarvis: Das ist interessant. Die Antwort lautet Ja und Nein. Ja, weil es auch andere Möglichkeiten gibt. Und Nein, weil Google schon eine Plattform ist, auf der wir aufsetzen können, ohne eine eigene Plattform bauen zu müssen. Google bietet uns die Möglichkeit, neue Unternehmen zu gründen, Kunden zu gewinnen, von diesen Kunden gefunden zu werden, neue Technologien zu nutzen. Das ist das Geheimnis des Web 2.0. Wir können neue Unternehmen mit sehr wenig Startkapital gründen. Aber nun zu Ihrem zweiten Punkt. Sie haben recht: Wir sollten Ausschau halten nach Bereichen, in denen Google einfach nicht gut ist oder eine Lücke offen gelassen hat. Die Verlagsindustrie ist wütend über die Google Buchsuche, aber sie hätten sie selbst starten sollen. Sie hätten rechtzeitig auf dem Markt sein müssen mit ihrer eigenen Online-Buchsuche. Die Medienindustrie ist sauer auf Google, weil die Suchmaschine einen Riesenumsatz mit Werbung macht. Nun ja, Google bietet halt Unternehmen einen effizienteren Werbekanal. Die Medienunternehmen hätten diesen Weg auch beschreiten können. Aber wo ist Google noch nicht König? Ich glaube, es gibt ein paar Bereiche. Einer ist das Live-Web.
Aber diese Lücke hat auch kein Medienunternehmen gefüllt, sondern ein kleines Start-Up namens Twitter…
Genau, ein schneller Dienst namens Twitter tauchte auf. Twitter ist nicht perfekt, zeigt aber die riesigen Möglichkeiten auf, die in Live-Netzverbindungen stecken, und darin, zu lernen, was Menschen live sagen. Das hat gerade erst begonnen und ist noch weitgehend unerschlossenes Terrain. Ein anderer Sektor ist das Lokale. Google beginnt gerade, lokale und sublokale Werbekunden für Onlinewerbung anzusprechen. Sie tun das für Google Maps und für das mobile Netz. Google-Chef Eric Schmidt sagt, dass sie künftig mehr Umsatz im mobilen als im klassischen Web erzielen werden. Ein weitere Chance sind Menschen. Google organisiert unsere gesamten Informationen, aber wer organisiert unsere Beziehungen? Google und Facebook stehen dabei im Wettbewerb. Und der ist noch nicht entschieden. Und dann gibt es ja noch das ”deep web“ mit den Informationen in Datenbanken, die über Suchmaschinen nicht gefunden werden können. Wie können wir das sinnvoll organisieren? Es gibt also jede Menge Herausforderungen für die Zukunft. Die sollten wir ins Auge fassen, statt immer nur zurück zu schauen.
Viele Verlage und Zeitungsjournalisten sehen aber weniger die Vorteile der Linkökonomie als die Nachteile: Google schöpft Profite von Printmedien ab. Verstehen Sie Ihre Sorgen?
Ja, aber diese Kritiker verstehen die Linkökonomie nicht. Der Wandel von der Inhalteökonomie zur Linkökonomie ist die Ursache dieses Krieges. Bisher ging es darum, die Inhalte zu besitzen und so oft möglich zu monetarisieren. Dieses Prinzip wird im Internet zerstört. Jetzt braucht man jeweils nur noch eine einzige Kopie. Es sind die Links zu dieser Kopie, die ihren Wert steigern. Die Linkökonomie bedingt drei Imperative. Der erste ist: Inhalte im Netz müssen offen zugänglich sein, damit sie viel verlinkt werden…
…Medienunternehmen würden das wahrscheinlich leichter verstehen, wenn sie die Links, die sie bekommen, besser monetarisieren könnten.
 Das ist der zweite Imperativ. Wer die Links bekommt, muss Wege finden, damit Umsätze zu erzielen. Der dritte Imperativ ist: die Linkökonomie bedingt Spezialisierung, nicht mehr vom Gleichen. Medienplattformen müssen sich von der Masse abheben, einzigartige Inhalte bieten, und die müssen außerordentlich gut sein. Dann können sie Spitzenreiter auf ihren jeweiligen Gebieten werden. Das Blog Techcrunch ist dafür ein gutes Beispiel: Sie beherrschen praktisch die Inhaltskategorie Web 2.0. Und die machen außerordentlich gute Umsätze. Aber die Annahme, dass Umsätze im Web auf den gleichen Wegen wie in Print zu erzielen sind, ist falsch.
Das ist der zweite Imperativ. Wer die Links bekommt, muss Wege finden, damit Umsätze zu erzielen. Der dritte Imperativ ist: die Linkökonomie bedingt Spezialisierung, nicht mehr vom Gleichen. Medienplattformen müssen sich von der Masse abheben, einzigartige Inhalte bieten, und die müssen außerordentlich gut sein. Dann können sie Spitzenreiter auf ihren jeweiligen Gebieten werden. Das Blog Techcrunch ist dafür ein gutes Beispiel: Sie beherrschen praktisch die Inhaltskategorie Web 2.0. Und die machen außerordentlich gute Umsätze. Aber die Annahme, dass Umsätze im Web auf den gleichen Wegen wie in Print zu erzielen sind, ist falsch.
Was ist daran falsch?
Wir setzen im Netz immer noch auf die alten Werbemodelle, die auf knappen Verfügbarkeiten von Werbeplätzen beruhen. Nur eine gewisse Menge Banner, nur eine gewisse Menge Seitenaufrufe, nur so und so viel Aufmerksamkeit. Google macht das ganz anders und verkauft Performance, also Leistung. Google sagt, nur wenn der Werbekunde erfolgreich ist, sind wir erfolgreich. Der vierte Imperativ lautet: Tue, was Du am besten kannst, und verlinke zum Rest. Die Linkökomomie schafft Effizienz. Wir neigen dazu, die Erlöse der Vergangenheit zum Maßstab zu nehmen und sie im Internet duplizieren zu wollen. Aber im Internet gibt es viel mehr Wettbewerb. Medienunternehmen sollten deshalb Google als eine Plattform betrachten, die es ihnen ermöglicht, das zu tun, was sie am besten können. Spezialisieren, Nischenmärkte entdecken, nicht jedem alles verkaufen wollen. Das macht die Unternehmen viel schlanker, preiswerter und gewinnbringender.
Sie haben an der CUNY Graduate School of Journalism ein Projekt gestartet, um erforschen, welche neuen Verlagsgeschäftsmodelle im Google-Zeitalter funktionieren könnten. Was glauben Sie denn nach den ersten Erkenntnissen, was funktionieren könnte?
Wir haben schon einige Dinge herausgefunden. Ein Medienhaus der Zukunft wird kleiner sein und Journalismus vor allem organisieren. Die Rolle von Journalisten wird sich wandeln. Journalisten werden vor allem Kuratoren, Aggregatoren und Journalismus-Lehrer sein. Wir haben untersucht, was passieren kann, wenn eine Zeitung in einer großen Stadt wie Philadelphia stirbt. Das Ergebnis war: Journalismus kann weiterleben. Wo vorher 300 Journalisten beschäftigt waren, geht es rein online-basiert auch mit 35. Aber diese 35 arbeiten mit einem Netzwerk von 3000 Bloggern und Bürgerjournalisten. Wir werden solche Netzwerke entstehen sehen.
Werden diese effizienteren Strukturen auch dafür sorgen, dass Anzeigen wieder attraktiver werden?
 Ich glaube, dass wir ganz neue lokale Ebenen der Werbung sehen werden. Es werden völlig neue Kundengruppen im Netz werben, die niemals in einer Zeitung geworben haben, weil das für sie im Maßstab zu groß und ineffizient war. Wir müssen aber herausfinden, mit welchen Angeboten wir ihnen dienen können. Ihnen zu dienen bedeutet wahrscheinlich, ihnen helfen, bei Google gut abzuschneiden, ihre Kundenbeziehungen aufzubauen und vieles mehr in diese Richtung. Ich glaube, auch die Anzeigenverkäufe werden künftig kollaborativer werden. Eine Inhouse-Unternehmensabteilung wird nicht reichen für den riesigen Teil der Netzbevölkerung, der als Werbekunden in Frage kommt. Es wird Bürger-Anzeigenverkäufer geben.
Ich glaube, dass wir ganz neue lokale Ebenen der Werbung sehen werden. Es werden völlig neue Kundengruppen im Netz werben, die niemals in einer Zeitung geworben haben, weil das für sie im Maßstab zu groß und ineffizient war. Wir müssen aber herausfinden, mit welchen Angeboten wir ihnen dienen können. Ihnen zu dienen bedeutet wahrscheinlich, ihnen helfen, bei Google gut abzuschneiden, ihre Kundenbeziehungen aufzubauen und vieles mehr in diese Richtung. Ich glaube, auch die Anzeigenverkäufe werden künftig kollaborativer werden. Eine Inhouse-Unternehmensabteilung wird nicht reichen für den riesigen Teil der Netzbevölkerung, der als Werbekunden in Frage kommt. Es wird Bürger-Anzeigenverkäufer geben.
Was ist mit Bezahl-Modellen für Inhalte? Warum sind Sie so skeptisch, dass sie funktionieren werden?
Ich bin nicht gegen Paid Content. Genauso wenig bin ich gegen gedruckte Zeitungen. Beides wird mir immer vorgeworfen. Das Wall Street Journal als Online-Abomodell, ist eine Ausnahme. Das sind Unternehmensabos, keine Privatnutzer-Abos. Ich glaube, dass Medienunternehmen mehr Geld verdienen können, wenn sie sich das Internet zunutze machen. Diese Lehre hat die New York Times gelernt, als sie die Bezahlschranke vor ihrem Internetangebot wieder geöffnet hat. Mehr Leute sind auf die Website gekommen. Ihre Zugriffe, ihr ”Google juice“ und ihre Umsätze sind gestiegen. In seinem Buch „Here Comes Everybody“ argumentiert Clay Shirky – und ich stimme ihm zu – dass wir alle Druckmaschinen bekommen haben, als das Internet erfunden wurde. Der Wert, eine echte Druckmaschine zu besitzen, ist auf Null geschrumpft. Schlimmer noch, Druckmaschinen sind nur noch ein Kostenfaktor. Wir können also nicht alte Geschäftsmodelle in die digitale Welt übertragen mit dem Argument: ”Die Leute haben früher für Informationen bezahlt, also sollten sie das auch künftig tun.“ Es gibt kein Geschäftsmodell, das auf dem Wort ”sollte“ basiert. Es gibt im Internetzeitalter niemanden mehr, der die einzige Druckerpresse besitzt. Es wird deshalb immer jemanden geben, der die Preise für Information unterbietet. Und wer glaubt, ein Geschäftsmodell auf der knappen Verfügkeit von Informationsquellen begründen zu können, der irrt sich – die sind nicht mehr knapp. Selbst exklusive Nachrichten werden nach ihrer Veröffentlichung zu Nachrichten, die sich herumsprechen, und somit ein Allerweltsgut. Einmal in die Welt gesetzt, gibt es keine Exklusivität mehr. Manche sagen, ”Ja, aber für Musik bei iTunes zahlen die Leute doch auch.“ Da gibt es einen großen Unterschied. Die Leute zahlen für Billy Joel. Wenn ich sänge, würde niemand dafür zahlen.
Wie beurteilen Sie die Plattform Spot.Us in San Francisco? Journalisten fangen mit einer investigativen Recherche erst an, wenn sie durch Spenden vorfinanziert wurde.
David Cohn ist großartig. Sein Spot.Us ist ein Weg, wie die Öffentlichkeit Journalismus unterstützen kann. Die Plattform kann aber die Aufgabe von Zeitungen nicht übernehmen.
Auf welcher Ebene funktioniert solch ein Modell am besten? Lokal, sublokal, regional?
 Auf dieser individuellen Ebene am besten lokal und sublokal. In den USA haben wir allerdings schon eine Tradition, dass unser National Public Radio durch Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen finanziert wird. Das gibt es so nicht in Europa. Bei Spenden- statt Steuer- oder Gebührenfinanzierung entscheide ich, wo mein Geld hingehen soll. Das ist ein kraftvolles Modell, vor allem in den USA mit ihrem ausgeprägten Spendenreflex. Wenn man untersuchen würden, welcher Anteil der Gesamtkosten von Medien heute in investigative Recherchen fließt, wäre der Anteil wahrscheinlich winzig. Ich sage das nicht als Beleidigung. Ich sage das, weil ich mir vorstellen kann, dass die öffentliche Unterstützung durch Spenden investigativen Journalismus wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau wie heute halten kann. Ich glaube, der Anteil kann sogar noch steigen, weil es im Internet effizientere Wege der Recherche gibt.
Auf dieser individuellen Ebene am besten lokal und sublokal. In den USA haben wir allerdings schon eine Tradition, dass unser National Public Radio durch Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen finanziert wird. Das gibt es so nicht in Europa. Bei Spenden- statt Steuer- oder Gebührenfinanzierung entscheide ich, wo mein Geld hingehen soll. Das ist ein kraftvolles Modell, vor allem in den USA mit ihrem ausgeprägten Spendenreflex. Wenn man untersuchen würden, welcher Anteil der Gesamtkosten von Medien heute in investigative Recherchen fließt, wäre der Anteil wahrscheinlich winzig. Ich sage das nicht als Beleidigung. Ich sage das, weil ich mir vorstellen kann, dass die öffentliche Unterstützung durch Spenden investigativen Journalismus wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau wie heute halten kann. Ich glaube, der Anteil kann sogar noch steigen, weil es im Internet effizientere Wege der Recherche gibt.
Sie sagen den Medien, es sei sinnlos, Nutzer auf die Zeitungs-Homepage zu zwingen, viel erfolgversprechender sei ”Frei-Haus-Lieferung“ auf die Webseiten, auf denen sich die Nutzer am liebsten aufhalten. Wo funktioniert das schon?
Wir sehen das heute bei RSS-Feeds, bei Videos, die man auf anderen Webseiten einbetten kann und bei Twitter. Das jüngste Beispiel ist der Guardian, der seinen Inhalte über eine Schnittstelle (API) frei verfügbar macht. National Public Radio hatte zeitweise eine Schnittstelle und in gewissem Maße haben das auch die New York Times und die BBC. Aber die Frage lautet dann schnell: Wie kann man damit Geld verdienen? Der Guardian stellt drei Bedingungen für die Nutzung seiner Schnittstelle. 1. Die Marke Guardian muss benutzt werden. 2. Nutzer müssen dem Werbenetzwerk des Guardian beitreten, aber sie können dort auch selbst Werbung vermarkten. 3. Die Inhalte müssen alle 24 Stunden erneuert werden, wegen möglicher Verleumdungsklagen nach britischem Recht. Wenn der Guardian Inhalte korrigieren muss, und die unkorrigierte Version über die APIs mit Hilfe des Guardian da draußen im Netz bleibt, dann bekäme er rechtliche Probleme. Das Wichtige bei all dem ist: Der Guardian wollte sich mit dem Internet verweben und hat die Stärken einer offenen Schnittstelle genutzt, um das zu erreichen. Das ist ein mutiger Anfang.
Kennen Sie auch ein deutsches Beispiel? Vielleicht Burdas deutscher Ableger des Glam-Netzwerkes?
Glam ist ein Netzwerk-Modell, das darauf basiert, dass Glam den einzelnen Mitgliedern hilft, bei der Monetarisierung erfolgreicher zu sein. Ein Beispiel ist aber auch, was Kai Diekmann bei Bild macht.
Sie mögen ihn, weil sie ihn dazu gebracht haben, bei Bild.de eine Flip-Videokamera einzusetzen…
 Genau, ich liebe diese Geschichte.Kai Diekmann sah die Flip und sah sofort die Möglichkeiten. Er sagte nicht etwa, ”Oh, die gebe ich meinen Redakteuren, damit sie mehr Videos produzieren können.“ Nein, er hat sofort erkannt, dass er damit die Bild-Nutzer mobilisieren kann, Videoinhalte für Bild zu produzieren. Er muss immer noch filtern, um die guten Videos zwischen all dem ganzen Katzencontent zu finden, aber er hat jetzt Zugang zu Inhalten. Das ist ein Weg, den Aufwand der Inhalteproduktion auf viele Schultern zu verteilen. Der Reflex der meisten Chefredakteure in den USA wäre gewesen: ”Super, ein neues Tool für Redakteure, um mehr Inhalte zu produzieren.“ Und die Redakteure hätten dann reflexartig gestöhnt.
Genau, ich liebe diese Geschichte.Kai Diekmann sah die Flip und sah sofort die Möglichkeiten. Er sagte nicht etwa, ”Oh, die gebe ich meinen Redakteuren, damit sie mehr Videos produzieren können.“ Nein, er hat sofort erkannt, dass er damit die Bild-Nutzer mobilisieren kann, Videoinhalte für Bild zu produzieren. Er muss immer noch filtern, um die guten Videos zwischen all dem ganzen Katzencontent zu finden, aber er hat jetzt Zugang zu Inhalten. Das ist ein Weg, den Aufwand der Inhalteproduktion auf viele Schultern zu verteilen. Der Reflex der meisten Chefredakteure in den USA wäre gewesen: ”Super, ein neues Tool für Redakteure, um mehr Inhalte zu produzieren.“ Und die Redakteure hätten dann reflexartig gestöhnt.
Sollen Zeitungen mit Bloggern kooperieren und zum Beispiel Blognetzwerke gründen?
Ja. Ich habe diese Idee schon viele Male in Deutschland vorgebracht, aber bisher bin ich immer gescheitert. Es gibt hierzulande für Zeitungen eine Chance, den neuen Markt der Blogs zu unterstützen, aber auch davon zu profitieren. Das Problem mit Blogs in Deutschland ist: Es gibt nicht genug, um Netzwerke zu schaffen. Die Antwort darauf sollte sein: Wie können wir Nutzer motivieren zu bloggen, weil sowohl die Blogger als auch die klassischen Medien profitieren? Sie können Geschäftsbeziehungen mit Bloggern aufbauen, die für beiden Seiten dienlich sind. Klassische Medien können sich Blogs aussuchen, mit denen sie kooperieren wollen, und nur für diejenigen Werbung verkaufen, die sie gut finden. Das ist ein vernünftiger Weg, in der digitalen Welt zu agieren. Burda nutzt die Kollaboration durch seine Beteiligung am Glam-Netwerk, an Scienceblogs und Sevenload. Das Bild-Modell, wo Nutzer Fotos und Videos einsenden, ist allerdings noch das alte Modell: „Gebt uns Euren Content“. Das neue Modell ist, den Nutzern zu helfen, selbst zu publizieren. Das ist ein Netzwerk. Ich glaube, darin liegt eine Riesenchance und Medienunternehmen sollten sie nutzen. Jemand wird sie nutzen, und vielleicht wird es kein Medienunternehmen sein.
Ist kollaborativer Journalismus für jedes Medium geeignet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Publikation wie das Wall Street Journal davon profitieren könnte, es sei denn, sie wollten ihre große Redaktion voller Spezialisten verkleinern.
Es ist nicht für jedes Medium und jede Geschichte geeignet. Es funktioniert aber durchaus auch bei Finanzthemen. Der Guardian hat kürzlich eine Geschichte zusammengestellt mit allen großen Übernahmen auf dem Finanzsektor. Sie hatten selbst weder Zeit noch Ressourcen, alle Daten zusammenzusuchen. Sie haben ihre Leser gefragt und die haben gemeinsam das Feature für den Guardian erstellt. Hier greift die „Ein-Prozent-Regel“ von Wikipedia. Nur ein Prozent der Nutzer von Wikipedia schreiben auch dafür. Wir müssen neue Möglichkeiten erkennen und Konzepte für neue Arten von Journalismus finden, die ohne die kollaborativen Möglichkeiten, die das Internet bietet, niemals möglich gewesen wären. Mein klassisches Beispiel ist der New Yorker Radiosender, der seine Hörer gebeten hat, in den Läden in ihrem Viertel den Preis von Milch, Bier und Salat herauszufinden, so dass er am Ende vergleichen konnte, in welchen Vierteln Wucherpreise verlangt wurden. Innerhalb von 24 Stunden haben 800 Leute mitgemacht. Das hätte kein Reporter leisten können. Da ist eine neue Form der Berichterstattung entstanden. Manche investigativen Geschichten über Skandale werden immer auf klassische Weise entstehen. Aber es gibt neue Arten von „Watchdog“-Geschichten, die nur deshalb entstehen und etwas bewirken können, weil sie kollobarativ zusammengetragen werden.
Sie sind ein 54jähriger Medienveteran, der alle möglichen neuen multimedialen Technologien umarmt. Was sagen Sie ihren skeptischen jüngeren Kollegen, die nicht Blogger, Live-Video-Blogger oder iPhone-App-Nutzer werden wollen?
 Wenn ich das kann, könnt Ihr das auch. Es ist einfacher, als es aussieht. Das ist ja gerade der Punkt: Es ist so einfach. Ich bin dafür, dass jeder Journalist in jeder Redaktion diese neue Instrumente beherrschen sollte. Dann verstehen Journalisten auch, warum die Welt solche Dinge benutzt. Der Grund ist: Weil es einfach ist. Dann werden diese Tools auch für Journalisten weniger mysteriös. Das ist der beste Dienst, den wir Journalisten erweisen können. Ich lehre meine Dozentenkollegen an der CUNY Graduate School of Journalism den Umgang mit diesen Dingen und das ist erhellend. Sie verstehen danach besser, wie sich die Welt verändert. Ein von Berufs wegen neugieriger Journalist sollte darüber Bescheid wissen. Es ist absolut keine Kunst, eine Flip-Kamera zu nehmen, auf den roten Knopf zu drücken und ein Video aufzunehmen.
Wenn ich das kann, könnt Ihr das auch. Es ist einfacher, als es aussieht. Das ist ja gerade der Punkt: Es ist so einfach. Ich bin dafür, dass jeder Journalist in jeder Redaktion diese neue Instrumente beherrschen sollte. Dann verstehen Journalisten auch, warum die Welt solche Dinge benutzt. Der Grund ist: Weil es einfach ist. Dann werden diese Tools auch für Journalisten weniger mysteriös. Das ist der beste Dienst, den wir Journalisten erweisen können. Ich lehre meine Dozentenkollegen an der CUNY Graduate School of Journalism den Umgang mit diesen Dingen und das ist erhellend. Sie verstehen danach besser, wie sich die Welt verändert. Ein von Berufs wegen neugieriger Journalist sollte darüber Bescheid wissen. Es ist absolut keine Kunst, eine Flip-Kamera zu nehmen, auf den roten Knopf zu drücken und ein Video aufzunehmen.
Sollte jeder Journalist wirklich ein Alleskönner mit jeder neuer Technik sein?
Nein. Aber jeder sollte die Hilfsmittel soweit beherrschen, dass er zu jeder Zeit eine Geschichte auf die gerade geeignetste Art erzählen kann. Wenn Journalisten Zeuge einer interessanten oder lustigen Szene werden von, sagen wir, Jarvis fällt von der Bühne, dann sollten sie die Szene filmen und live-bloggen können. Das ist dann keine richtige Videoreportage, aber ein zehnsekündiger Bewegtbild-Moment. Man sollte stets bereit sein, neue Werkzeuge einsetzen zu können. Das war genauso, als Computer in die Redaktionen einzogen. 1974, als ich ein junger Autor war, hat das die Art, wie ich geschrieben habe, verändert.
Vielleicht sind Journalisten in den USA tatsächlich neugieriger. In Deutschland betrachten viele Kollegen neue Technologie eher mit Skepsis. Sie glauben, dass sich dadurch der Wert ihrer alten Fähigkeiten vermindert.
Das ist altes Kontrolldenken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand glauben kann, etwas nicht zu lernen, würde ihn besser dastehen lassen. Das ist so offensichtlich lächerlich. Journalisten sollten per Definition neugierig auf neue Technologie sein. Teil des Problems ist allerdings, dass wir Insider neue Medien oft wie eine Geheimwissenschaft aussehen lassen. Wir müssen weniger orthodox werden, uns öffnen und andere großzügig an unserem Wissen teilhaben lassen.
Fotos: nextconference, elmine, next09 Flickr photostream


 Well, that’s the second imperative. Who get’s the links must find ways to monetize them. And the third imperative is: the link economy demands specialization, not commodity content. So you must stand out and be unique and do something uniquely well. Then you can own that category. Techcrunch is a brilliant blog that owns the web 2.0 category. And they monetize beautifully. But the idea that we can monetize as we did in the past is what’s wrong here.
Well, that’s the second imperative. Who get’s the links must find ways to monetize them. And the third imperative is: the link economy demands specialization, not commodity content. So you must stand out and be unique and do something uniquely well. Then you can own that category. Techcrunch is a brilliant blog that owns the web 2.0 category. And they monetize beautifully. But the idea that we can monetize as we did in the past is what’s wrong here. I think we’re going to see a local level. A new whole new group of advertisers who were never served by newspapers, because newspapers were too big and too ineficient. We’ve got to figure out how to serve them. Serving them will be probably be helping them do well on Google, helping them build customer relationships and more whole new ways. I think ad sales will become more collaborative. One sales office is not going to scale against this huge web populalation. We willl see citizen sales.
I think we’re going to see a local level. A new whole new group of advertisers who were never served by newspapers, because newspapers were too big and too ineficient. We’ve got to figure out how to serve them. Serving them will be probably be helping them do well on Google, helping them build customer relationships and more whole new ways. I think ad sales will become more collaborative. One sales office is not going to scale against this huge web populalation. We willl see citizen sales. On this individidual level hyperlocal and local. But we have the tradition in the US of National Public Radio supported not through taxdollars but through contributions from both foundations and individuals. That doesn’t exist as much in Europe. In the case of contributions other than through tax-funding I’ll decide where my money should go to. I think that’s a very powerful model, especially, because we already have that contribution reflex. If you did an audit of all the journalistic resources in a market and all the output then analyzed what portion of the huge amount of money goes into investigative journalism today the portion would be tiny. I don’t say that as an insult, I just say that it becomes conceivable to me that public support though indivuals and foundations can probably suppport investigative journalism on a similar level than what it is today. Indeed, I think it could grow, because there are also ways to do it more efficiently.
On this individidual level hyperlocal and local. But we have the tradition in the US of National Public Radio supported not through taxdollars but through contributions from both foundations and individuals. That doesn’t exist as much in Europe. In the case of contributions other than through tax-funding I’ll decide where my money should go to. I think that’s a very powerful model, especially, because we already have that contribution reflex. If you did an audit of all the journalistic resources in a market and all the output then analyzed what portion of the huge amount of money goes into investigative journalism today the portion would be tiny. I don’t say that as an insult, I just say that it becomes conceivable to me that public support though indivuals and foundations can probably suppport investigative journalism on a similar level than what it is today. Indeed, I think it could grow, because there are also ways to do it more efficiently.


 Das ist der zweite Imperativ. Wer die Links bekommt, muss Wege finden, damit Umsätze zu erzielen. Der dritte Imperativ ist: die Linkökonomie bedingt Spezialisierung, nicht mehr vom Gleichen. Medienplattformen müssen sich von der Masse abheben, einzigartige Inhalte bieten, und die müssen außerordentlich gut sein. Dann können sie Spitzenreiter auf ihren jeweiligen Gebieten werden. Das Blog Techcrunch ist dafür ein gutes Beispiel: Sie beherrschen praktisch die Inhaltskategorie Web 2.0. Und die machen außerordentlich gute Umsätze. Aber die Annahme, dass Umsätze im Web auf den gleichen Wegen wie in Print zu erzielen sind, ist falsch.
Das ist der zweite Imperativ. Wer die Links bekommt, muss Wege finden, damit Umsätze zu erzielen. Der dritte Imperativ ist: die Linkökonomie bedingt Spezialisierung, nicht mehr vom Gleichen. Medienplattformen müssen sich von der Masse abheben, einzigartige Inhalte bieten, und die müssen außerordentlich gut sein. Dann können sie Spitzenreiter auf ihren jeweiligen Gebieten werden. Das Blog Techcrunch ist dafür ein gutes Beispiel: Sie beherrschen praktisch die Inhaltskategorie Web 2.0. Und die machen außerordentlich gute Umsätze. Aber die Annahme, dass Umsätze im Web auf den gleichen Wegen wie in Print zu erzielen sind, ist falsch. Ich glaube, dass wir ganz neue lokale Ebenen der Werbung sehen werden. Es werden völlig neue Kundengruppen im Netz werben, die niemals in einer Zeitung geworben haben, weil das für sie im Maßstab zu groß und ineffizient war. Wir müssen aber herausfinden, mit welchen Angeboten wir ihnen dienen können. Ihnen zu dienen bedeutet wahrscheinlich, ihnen helfen, bei Google gut abzuschneiden, ihre Kundenbeziehungen aufzubauen und vieles mehr in diese Richtung. Ich glaube, auch die Anzeigenverkäufe werden künftig kollaborativer werden. Eine Inhouse-Unternehmensabteilung wird nicht reichen für den riesigen Teil der Netzbevölkerung, der als Werbekunden in Frage kommt. Es wird Bürger-Anzeigenverkäufer geben.
Ich glaube, dass wir ganz neue lokale Ebenen der Werbung sehen werden. Es werden völlig neue Kundengruppen im Netz werben, die niemals in einer Zeitung geworben haben, weil das für sie im Maßstab zu groß und ineffizient war. Wir müssen aber herausfinden, mit welchen Angeboten wir ihnen dienen können. Ihnen zu dienen bedeutet wahrscheinlich, ihnen helfen, bei Google gut abzuschneiden, ihre Kundenbeziehungen aufzubauen und vieles mehr in diese Richtung. Ich glaube, auch die Anzeigenverkäufe werden künftig kollaborativer werden. Eine Inhouse-Unternehmensabteilung wird nicht reichen für den riesigen Teil der Netzbevölkerung, der als Werbekunden in Frage kommt. Es wird Bürger-Anzeigenverkäufer geben. Auf dieser individuellen Ebene am besten lokal und sublokal. In den USA haben wir allerdings schon eine Tradition, dass unser National Public Radio durch Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen finanziert wird. Das gibt es so nicht in Europa. Bei Spenden- statt Steuer- oder Gebührenfinanzierung entscheide ich, wo mein Geld hingehen soll. Das ist ein kraftvolles Modell, vor allem in den USA mit ihrem ausgeprägten Spendenreflex. Wenn man untersuchen würden, welcher Anteil der Gesamtkosten von Medien heute in investigative Recherchen fließt, wäre der Anteil wahrscheinlich winzig. Ich sage das nicht als Beleidigung. Ich sage das, weil ich mir vorstellen kann, dass die öffentliche Unterstützung durch Spenden investigativen Journalismus wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau wie heute halten kann. Ich glaube, der Anteil kann sogar noch steigen, weil es im Internet effizientere Wege der Recherche gibt.
Auf dieser individuellen Ebene am besten lokal und sublokal. In den USA haben wir allerdings schon eine Tradition, dass unser National Public Radio durch Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen finanziert wird. Das gibt es so nicht in Europa. Bei Spenden- statt Steuer- oder Gebührenfinanzierung entscheide ich, wo mein Geld hingehen soll. Das ist ein kraftvolles Modell, vor allem in den USA mit ihrem ausgeprägten Spendenreflex. Wenn man untersuchen würden, welcher Anteil der Gesamtkosten von Medien heute in investigative Recherchen fließt, wäre der Anteil wahrscheinlich winzig. Ich sage das nicht als Beleidigung. Ich sage das, weil ich mir vorstellen kann, dass die öffentliche Unterstützung durch Spenden investigativen Journalismus wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau wie heute halten kann. Ich glaube, der Anteil kann sogar noch steigen, weil es im Internet effizientere Wege der Recherche gibt.


 Emer Beamer
Emer Beamer  A special event at the Global Media Forum hosted by Germany’s global broadcaster Deutsche Welle is the symposium
A special event at the Global Media Forum hosted by Germany’s global broadcaster Deutsche Welle is the symposium 
 The Guardian has visualized all the data in the MP expense scandal (who claimed what? who paid it back? who didn’t?)
The Guardian has visualized all the data in the MP expense scandal (who claimed what? who paid it back? who didn’t?)  Attractive content on web pages that really stands out is often designed in multimedia packages. Again the New York Times has gone a long way to experiment with being much more than a printed paper.
Attractive content on web pages that really stands out is often designed in multimedia packages. Again the New York Times has gone a long way to experiment with being much more than a printed paper.
 Who pays for a story, gets to decide which story will be researched and published.
Who pays for a story, gets to decide which story will be researched and published.  recherchiert, linkt in ihrer Rubrik ”Breaking on the Web“ nach draußen. ProPublica wird von Paul Steiger, (ex Wall Street Journal und Stephen Engelberg (ex The Oregonian und New York Times) geleitet.
recherchiert, linkt in ihrer Rubrik ”Breaking on the Web“ nach draußen. ProPublica wird von Paul Steiger, (ex Wall Street Journal und Stephen Engelberg (ex The Oregonian und New York Times) geleitet.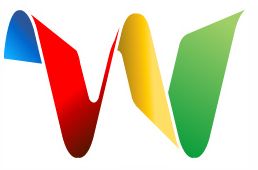 mehrere Autoren gleichzeitig an Texten und Notizen schreiben. Die ersten Rezensionen habe ich meinen
mehrere Autoren gleichzeitig an Texten und Notizen schreiben. Die ersten Rezensionen habe ich meinen 